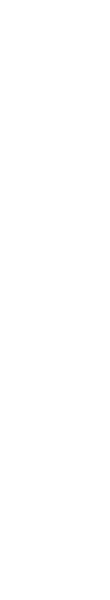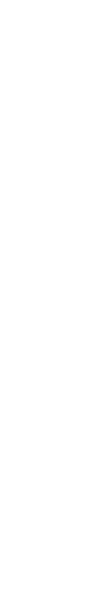Mi 04.12.2024, 19.00 - 22.00 Uhr |
Großes Haus
Giuseppe Verdi
Luisa Miller
Einführung um 18.20 Uhr
„Luisa Miller“ ist Giuseppe Verdis dritte Vertonung eines Stückes von Friedrich Schiller. „Es ist ein großartiges Drama, voller Leidenschaft und theatralisch sehr effektvoll“, schrieb der Komponist an den Librettisten Salvadore Cammarano über „Kabale und Liebe“. Um den Erwartungen der Zensur und des Publikums zu entsprechen, musste Verdi das Stück zunächst auf ein operntaugliches Libretto reduzieren, wodurch sich der Fokus von dem politischen Stoff Schillers auf das Familiendrama verschob. Verdi gelangen in seiner 1849 in Neapel uraufgeführten Oper herausragende Charakterstudien aller Protagonisten. In diesem Werk legte er den Grundstein für viele „Verdi-Typen“ späterer Jahre, wie Jago, Giorgio Germont, Aida oder Desdemona. An der Staatsoper Hamburg war „Luisa Miller“ 1981 als Hamburger Erstaufführung in einer Neuproduktion zu erleben, die musikalische Leitung hatte Giuseppe Sinopoli, Regie und Ausstattung übernahm damals Luciano Damiani.
Inszenierung: Andreas Homoki
Bühnenbild: Paul Zoller
Kostüme: Gideon Davey
Licht: Franck Evin
Premiere am: 16.11.2014
In italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln
Unterstützt durch die Stiftung zur Förderung der Hamburgischen Staatsoper
Nach dem außerordentlichen Echo der Frühwerk-Trilogie in der letzten Spielzeit setzen Sie jetzt eine Oper auf den Spielplan, die zwar unmittelbar auf „La Battaglia di Legnano“ folgt, aber in Genre und Stil einen totalen Umbruch für Verdi bedeutete. Geschieht das bewusst?
Absolut. „Luisa Miller“ ist das letzte Stück aus seinen sogenannten Galeerenjahren, wobei aus diesem Zeitraum einige Werke dabei sind, die bereits einen reiferen Verdistil aufweisen, man denke an „Nabucco“, „Macbeth“ oder auch „I due Foscari“. Bei „Luisa Miller“ erleben wir schon den Komponisten der mittleren Periode von „Rigoletto“, „La Traviata“ und „Il Trovatore“. Die Partie des Miller, Luisas Vater, ist eine der brillantesten Partien, die Verdi für einen Bariton schrieb, stilistisch nicht mehr weit entfernt von der Titelfigur des „Rigoletto“. Und auch die Figur der Luisa ist eher charakteristisch für den Spätstil Verdis, in dem eine Sopranrolle anfangs jung und naiv erscheint, mit einer gewissen Leichtigkeit in der Stimme, die dann immer dramatischer und tragischer ausgeformt wird, ein bisschen vergleichbar mit der Leonora im „Trovatore“, die man ebenfalls nicht zu schwer besetzen darf, erst recht nicht bei einer ungekürzten Fassung, etwa bei der Cabaletta, für die Verdi ausdrücklich eine bewegliche Stimme fordert. Die Musik in „Luisa Miller“ ist von großer poetischer Ausdruckskraft. Ein neuer auffälliger Aspekt besteht darin, dass es kaum noch die Verwendung der Banda gibt. Es ist Verdis erste Oper, in der die Bühnenmusik theatralisch keine Rolle mehr spielt. Und auch der Chor bestimmt den Handlungsablauf nicht mehr in dem Maße wie in früheren Werken. Es gibt zwar noch, vor allem an den Aktanfängen, große Chorszenen, aber die Handlung selbst wird stärker an diese Familientragödie gebunden.
Während es bei Schiller um einen letztlich zum Scheitern verurteilten Freiheitsappell in einer von Korruption durchsetzten geschlossenen Gesellschaft geht, konzentriert sich Verdis „Luisa Miller“ weit mehr auf die erwähnte Familientragödie und dabei auf den Vater-Kind-Konflikt von extremer Zuspitzung…
Ja, so ist es und in diesem Fall gibt es eben in dramatischer Steigerung zwei Väter und zwei Kinder. Man kann natürlich zahlreiche Parallelen in einigen Opern Verdis finden: Die für Verdi so entscheidende dramatische Konstellation von der gefühlvollen Tochter und dem unbeugsamen Vater erleben wir danach wieder in „Rigoletto“, dann in „La Traviata“ und so weiter. Nur kommt in „Luisa Miller“ der Konflikt zwischen den beiden Vaterfiguren Miller und Graf Walter als Kontrast zweier immens starker Persönlichkeiten hinzu. Und dies weist voraus auf vergleichbare Persönlichkeitsstrukturen wie später in „Don Carlo“ oder „Simon Boccanegra“. Der Konflikt zwischen dem Bass Graf Walter und dessen Sohn Rodolfo, dem Tenor, gibt einen klaren Hinweis, worauf Verdi in dramatischen Situationen hinaus will, etwa im späteren „Don Carlo“. Es ist schon interessant, dass Verdi, der ja eine große politische Persönlichkeit war, in seiner Oper „Luisa Miller“ die gesellschaftspolitische Ebene von „Kabale und Liebe“ zugunsten des Familiendramas in den Hintergrund rückt. Darüber habe ich lange mit dem Regisseur Andreas Homoki gesprochen, der die soziale Sprengkraft, die sich hinter der Handlung verbirgt, akzentuieren will, was ich auch sehr angemessen finde. Und das gilt natürlich vor allem für ein deutsches Publikum, das Schillers „Kabale und Liebe“ kennt, und für das es wichtig ist, dass dieser Aspekt nicht untergeht.
Kann man die verschiedenen Macht-Konstellationen in der musikalischen Interpretation verschärfen?
Verdi zeigt, dass Miller die gefühlvollere und differenziertere Figur von den beiden Vätern ist. Er kann Luisas Verbindung mit Rodolfo nicht ohne Vorbehalt zustimmen, weil er Angst hat, dass seine Tochter enttäuscht werden könnte. Verdi hat Miller mit einer ungeheuer ausdrucksstarken Musik versehen, zum Beispiel mit ausgedehnten, von Triolen begleiteten Kantilenen. Die Figur des Grafen Walter zeichnet Verdi dagegen viel kantiger. Seine Musik ist bewusst konventioneller gestaltet, die Tonarten sind eher „gerade“, es gibt weniger Melismen in der Vokallinie. Er macht also einen klaren Unterschied zwischen den beiden Figuren, musikalisch und vor allem vom stimmlichen Profil.
Zu Beginn der Oper erleben wir eine glückliche Beziehung zwischen der bürgerlichen Luisa und dem adeligen Rodolfo, die dann in kürzester Zeit durch die Intrige von Wurm zerstört wird …
Der Wurm ist eine interessante Figur! In Verdis späteren Opern war der Verräter oder Intrigant immer ein Bariton, wie Jago oder Paolo in „Simon Boccanegra“. Hier befinden wir uns in einem völlig anderen Umfeld. Es gibt in dem ganzen Werkkanon Verdis keine einzige Figur, die mit Wurm vergleichbar wäre. Nicht einmal der Großinquisitor in „Don Carlos“, ebenfalls ein Bass und der „böse Geist“ in dem Stück. Während aber der Großinquisitor eine edle, weil allmächtige Figur ist, finden wir bei dem heimtückischen und intriganten Wurm gar nichts Edles. Nein, Verdi schenkt ihm nicht viel Sympathie und gibt ihm keine eigene musikalische Nummer. Wurm könnte man auch nicht mit Sparafucile in „Rigoletto“ vergleichen, der ein Auftragsmörder ist. Doch das ist schließ lich dessen Beruf, und man hat das Gefühl, dass Verdi diesen Bass halbwegs mit Humor gezeichnet hat. Bei Wurm ist kaum Humor zu finden. Eigentlich merkwürdig, da Verdi in einem Brief an seinen Librettisten Salvadore Cammarano forderte, er möge diese Figur skurril und grotesk entwerfen.
Ein weiterer extremer Charakter ist Rodolfo, der sich in einer Art kopfloser Rebellion gegen seinen Vater übt …
Rodolfo ist ein problematischer Charakter, auch im musikalischen Sinn. Er ist für mich als Dirigentin alles andere als leicht zu fassen. In Verdis Gestaltung deutet er zu Beginn ein bisschen auf den Duca in „Rigoletto“ hin, entpuppt sich dann als treuer Edler wie Gabriele Adorno in „Simon Boccanegra“. Er wandert ein wenig hin und her zwischen bürgerlicher Empfindsamkeit und dem Pathos der Tenorhelden aus den Frühwerken. Manchmal erscheint er tatsächlich wie ein jugendliches Abbild seines Vaters, den er ja mit einer alten Geschichte und seinem Wissen um dessen Verbrechen erpresst. Er zwingt Wurm in das Duell auf Leben und Tod, und schließlich wird er zum Mörder an seiner Geliebten. Trotzdem, er lässt sich von seinen momentanen Gefühlen leiten und gewinnt unsere Sympathie nicht zuletzt durch seine außergewöhnlichen Gesangslinien, aber nicht in dem Maß wie Luisa.
Die Oper heißt ja nicht „Kabale und Liebe“, sondern „Luisa Miller“, ein einfaches Mädchen aus dem Volk, unerschütterlich in ihrem Glauben, durchsetzungsfähig, unbeugsam, eigentlich eine Heldin …
Das ist richtig. Luisa ist der dominierende Mittelpunkt. Dass es am Ende für sie eigentlich eine Rettung bedeuten würde, mit dem Vater zu fliehen, ist eine starke Aussage. Es wäre auch eine politisch kluge Lösung. Dadurch zeigt Verdi die mögliche Zukunft der bürgerlichen Klasse an, aber auch deren Unvereinbarkeit mit der höfischen. Schillers Drama ist ja im Vorfeld der Französischen Revolution entstanden. Gerade diesen Aspekt möchte Andreas Homoki wie bereits erwähnt in seiner Interpretation und in seinen Bildern deutlich unterstreichen.
Kommen wir auf die zweite Frau in „Luisa Miller“ zu sprechen, Luisas adelige Rivalin Federica von Ostheim …
Diese Federica von Ostheim ist eine kuriose Figur. Sie ist zwar sehr nobel, aber man hat das Gefühl, sie bringt keine wirklich neuen Konflikte in die Handlung. Für mich als Musikerin ist es viel wichtiger, warum Verdi trotz dieser Einschränkungen der Figur der Federica von Ostheim quasi als Opernversion von Schillers Lady Milford großartige musikalische Möglichkeiten bietet, beispielsweise in den ausladenden Ensembles oder in dem einzigartigen a-cappella-Abschnitt aus dem Quartett des zweiten Aktes.
Man sieht die Oper „Luisa Miller“ heute eher düster, skeptisch, ausweglos, als wären die Figuren von allem Anfang an verurteilt, unterzugehen, nicht nur Luisa … Empfinden Sie das auch so?
Nein, ich sehe das Stück nicht so. Das ist das Markante bei Verdi: Man hat immer das Gefühl, dass er selbst an die Rettung durch die Liebe geglaubt hat. Und dann zeichnet er so eine unverwechselbare Figur wie Luisa, die sich noch im Angesicht des Todes die Hoffnung auf ein besseres Jenseits bewahrt. Das ist das, was ich vorhin meinte: Luisa macht eine aufregende Entwicklung durch, von einem auf seine Gefühle setzenden Mädchen bis hin zu einer die Konsequenz ihrer Empfindung kompromisslos annehmenden Frau. Das Stück verabschiedet sich, während wir Schritt für Schritt hindurchgehen, quasi von der Tradition des reinen Belcanto und weist immer eindringlicher auf die späteren Entwicklungen im Verdischen Opernschaffen hin. Musikalisch verändert sich die formale Struktur von Akt zu Akt. Genau das ist es: Wir Dirigenten lieben „Luisa Miller“, weil wir diese Entwicklung so gerne hautnah erleben …
Es gibt also diese „schönen“ Belcanto-Stellen in dieser Oper. Und es gibt die bis dahin außergewöhnlichen Ausdrucksformen. Geht man in der konkreten Umsetzung da als Dirigentin unterschiedlich heran? Also stellt man einzelne Dinge heraus, trotz der Form der Nummernoper, oder muss man sich beim doch noch „frühen Verdi“ um einen großen Bogen bemühen?
Das ist sicher der Anspruch gerade in diesem Werk, einerseits die große Linie hindurch zu ziehen, obwohl es formal in einzelne Szenen geteilt ist und in ganz unterschiedlichen Welten angesiedelt ist. Es gilt für mich den großen Bogen zu finden, vor allem im Bemühen, dass die Teile dann nicht mehr in die traditionell geschlossenen Nummern zerfallen, also mit dem normalen Ablauf: Chor, Arie, Duett, Terzett, Chor, Finale. Um es kategorisch zu wiederholen: Das fordert dieses Stück vom Dirigenten und vom Regisseur: Eine konsequente Linie muss durchgehalten werden. Und dabei kann man eigentlich immer wieder an diese zwei Figuren Luisa und Miller anknüpfen, weil dies die beiden sind, welche die Entwicklung durch das gesamte Stück machen. Weder Wurm noch Walter und auch nicht Rodolfo.
Bei den drei Verdi-Opern der vergangenen Spielzeit haben Sie genaue Quellenrecherchen betrieben und bei „Luisa Miller“ wird es genau so gewesen sein?
So ist es. Ich war kurz vor der Sommerpause für drei Tage in Mailand in der Pinacoteca Brera. Da ist das Verdi Archiv von Ricordi untergebracht, und ich hatte Zugang zu den Autographen-Partituren. Von „Luisa Miller“ gibt es eine kritische Ausgabe, die wirklich sehr aufschlussreich ist und die zahlreiche detaillierte Informationen liefert. Trotzdem gibt es Stellen, wo ein Dirigent eigentlich keine klare Aussage über die Aufführungspraxis aus der kritischen Ausgabe entnehmen kann. Und dann erkennt man bei den älteren Ausgaben, dass es die Entscheidung von einer einzelnen Person war, wie man es aufführen sollte. Für mich ist es wie eine Erleuchtung, wenn ich die Partitur vor mir sehe. Gibt es eine Einzeichnung in den Violinen, die anders ist als in den Flöten? Klar ist in der kritischen Ausgabe alles notiert, aber wenn ich das Original vor mir sehe, hat es eine ganz andere Wirkung. Eine der schwierigsten Entscheidungen bei Verdi: Handelt es sich bei diesem Symbol um einen Akzent oder ist es ein Decrescendo oder ist es beides? Und da kann man eigentlich nur an seine eigene Erfahrung mit diesen Werken anknüpfen. Ich habe sowohl Verdis erste Oper als auch seine letzte dirigiert und dazwischen mindestens zwölf weitere Stücke von ihm. Man schöpft dann doch sehr bewusst aus der eigenen Erfahrung. Aus genau dieser Erkenntnis heraus ist es für mich persönlich sehr wichtig, gerade jetzt „Luisa Miller“ zu machen, nachdem wir hier an der Staatsoper exakt vor einem Jahr „La Battaglia di Legnano“ realisiert haben. Denn es ist interessant, sich zu vergegenwärtigen, wie unterschiedlich diese beiden Werke sind, obwohl ihre Entstehungszeit gerade mal ein Jahr auseinanderliegt. „Luisa Miller“ ist das Brückenstück zu Verdis mittleren Schaffensperiode, während „La Battaglia di Legnano“ noch den „muskulösen“ Frühwerken zuzuordnen ist. Mit „Luisa Miller“ war für Verdi die Zeit der großen historischen und biblischen Stoffe unwiderruflich vorbei.